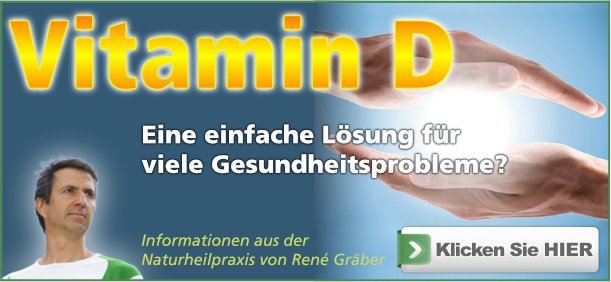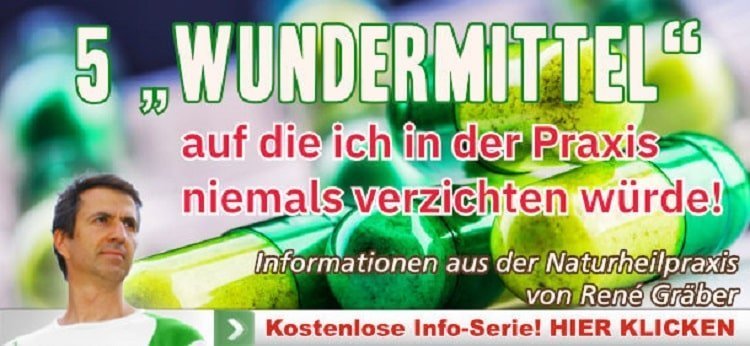Beginnen wir beim Vitamin A zunächst damit, wo er vorkommt, in welchen Formen und welche Wirkung es hat…
Vorkommen, Formen und Wirkung
Vitamin A ist in Fleisch, Fisch, Eiern und Milch enthalten. Besonders hoch ist der Gehalt in der Leber, weswegen Löwen zuerst die Innereien fressen, bevor sie sich dem Muskelfleisch zuwenden. Retinol und Retinal sind zwei aktive Formen des Vitamins.
Carotine sind die Vorstufen des fettlöslichen Vitalstoffes in grünen, rotem und gelbem Obst und Gemüse. Der Körper kann Carotinoide in funktionsfähiges Vitamin A umwandeln. Bei vielen Menschen ist diese Fähigkeit jedoch beeinträchtigt.
Vitamin A ist für die Lichtwahrnehmung in der Netzhaut erforderlich. Ein Mangel an dem Vitalstoff zeigt sich daher zuerst an Sehstörungen, vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen. Aber auch Organ-Schäden und eine geschwächte Abwehrkraft können die Folgen einer Unterversorgung sein.
Denn der Körper braucht den Vitalstoff für den Zellschutz und für Wachstums- und Entwicklungs- sowie Fortpflanzungs-Prozesse. Auch für das Immunsystem ist Vitamin A unentbehrlich. Vitamin A fördert neben der Fruchtbarkeit auch die Blutbildung.
Die Wirkungen von Vitamin A im Körper
Vitamin A hat einen indirekten Einfluss auf das Immunsystem, indem es Struktur und Funktion der Zellmembranen der Haut- und Schleimhautzellen unterstützt. Dadurch wird eine effektive Barriere gegen Mikroorganismen in den Luftwegen, im Verdauungstrakt und in den Harnwegen aufgebaut.
Vitamin A aktiviert die T-Lymphozyten, die Antikörper produzieren. Somit stärkt der Vitalstoff unsere Abwehrkraft.
Vitamin A initiiert und steuert die Produktion von Steroidhormonen und ist an der Differenzierung von Stammzellen zu Erythrozyten beteiligt. Es mobilisiert Eisen zwecks Einbau ins Hämoglobin der Erythrozyten, spielt eine Rolle bei der Synthese von Proteinen und Fetten und ist unerlässlich für die Bildung von Androgenen und Östrogenen.
So bedarf es einer optimalen Vitamin-A-Versorgung, damit Spermienzahl, -form, und –beweglichkeit physiologisch normal sind.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter dazu an:
Der Bedarf und die Quellen von Vitamin A
Der Bedarf an Vitamin A beträgt für einen durchschnittlichen Erwachsenen rund 1 mg pro Tag. Gute Quellen sind Fleisch, besonders Leber, Fisch sowie Milch und Milch-Produkte.
Um den Bedarf zu decken, müssen beispielsweise 100 g Leber verzehrt werden, die einen sehr hohen Gehalt an Retinol hat. Um dieselbe Menge zu erreichen, sind 200 g Thunfisch, 400 g Gouda oder 1 kg Makrele erforderlich. Pflanzliche Kost liefert Carotin, das unser Körper zu Vitamin A umwandeln kann.
Zu Bedarfsdeckung müssen etwa 120 g Spinat verzehrt werden. Die reichhaltigste Quelle sind Möhren: 65 g täglich versorgen den Verbraucher mit der Tagesration. Zu berücksichtigen ist, dass der Körper in Zeiten schwerer Krankheiten mehr Vitamin A braucht.
Um Vergiftungserscheinungen und Dauerschäden zu vermeiden, sollten nicht mehr als 0,75 mg Vitamin A täglich aufgenommen werden.
Vitamin-A-Mangel
Ein Vitamin-A-Mangel (Hypovitaminose) kommt bei Mangel- oder Fehlernährung sowie bei Resorptions-Störungen des Darmes vor. Verschiedene Darmerkrankungen stellen daher ein Risiko für die Hypovitaminose dar.
Auch ein exzessiver Alkoholkonsum und seine Begleiterscheinungen kann den Vitalstoffmangel herbeiführen. Ein weiterer Grund ist ein zu geringer Fettverzehr, denn das fettlösliche Vitamin kann dann nicht ausreichend aufgenommen werden.
Ein Vitamin-A-Mangel macht sich vor allem durch eine besonders im Dämmerlicht auftretende Sehschwäche bemerkbar. Auch andere Beschwerden treten an den Augen auf.
Die Bindehaut und die Hornhaut werden trocken, die Hornhaut und kann Geschwüre zeitigen. Die sogenannten, weißen „Bitot-Flecken“ im Auge sind das erste Anzeichen für eine Rückbildung der Hornhaut. Zudem leiden die Schleimhäute unter der Hypovitaminose.
Das Zahnfleisch, die Speicheldrüsen und die Atemwege mit samt der Lunge entzünden sich. Mit betroffen ist auch die Darmschleimhaut, wodurch die Resorption von Nährstoffen vermindert ist. Dies verstärkt den Vitaminmangel nochmals.
Eine zunehmende Blutarmut führt zu verschlechterter Kondition, Abgeschlagenheit und Atemproblemen. Bei Heranwachsenden ist das Wachstum behindert, was sich an einer gehemmten Zahnbildung bemerkbar macht. Beim Mann ist die Fruchtbarkeit beeinträchtigt.
Gravierend ist auch eine Erhöhung des Hirninnendrucks.
Dann droht die Entstehung eines Wasserkopfes (Hydrocephalus) mit zerebralen Schäden. Bei Schwangeren kommt es zu Fehlbildungen der Leibesfrucht.
Bei diesen Symptomen kann der Arzt mit einer Blutuntersuchung den Vitamin-A-Mangel feststellen. Möglicherweise müssen Fehler in der Ernährung korrigiert oder eine Grunderkrankung behandelt werden, die die Hypovitaminose begünstigt. Eventuell ist eine zeitweise oder dauernde Supplementierung mit Vitamin A notwendig.
Vitamin-A-Vergiftung
Es wird ja allgemein behauptet, dass Menschen, die zu viel Lebensmittel mit hohem Gehalt an Vitamin A (vor allem Lebertran oder Möhren) zu sich nehmen, eine „Vergiftung“ (=Intoxikation) riskieren.
Aber mal im Ernst: wer nimmt den heute noch Lebertran? Und wie viele Möhren soll man denn essen? Die kriegt keiner runter! Wenn man dazu noch die Abnahme der Vitalstoffe in Obst und Gemüse betrachtet, dann wird das Ganze geradezu lächerlich! Lesen Sie dazu unbedingt mal meinen Report „Vitalstoffverlust in Obst und Gemüse„.
Wo ich tatsächlich ein Problem sehe, ist bei der Einnahme hochdosierter Vitamin A Präparate. Aber auch hier ist die Sache relativ einfach. Ich rate dazu den Vitamin-Status testen zu lassen.
Gut: so eine Blutanalyse ist nicht billig. Aber es geht auch anders. Als „Anhalt“ (in Verbindung mit vorliegenden Beschwerden) kann man zum Beispiel so einfache Geräte wie den Bioscan nutzen.
Symptome die bei einer Vitamin A Vergiftung auftreten können:
Zunächst treten Kopfschmerzen und Übelkeit bis zum Erbrechen auf, bis sich schließlich Milz und Leber vergrößern und entzünden können. Zudem erhöht sich der Kalzium-Spiegel, wodurch Herz- und Nierenerkrankungen drohen. Auch die Blutgefäße verändern sich und Gelenkbeschwerden treten auf.
Die chronische Vitamin-A-Hypervitaminose hat bei Heranwachsenden Entwicklungsstörungen und Haarausfall zur Folge. Werdende Mütter riskieren Fehlbildungen bei ihren Babys.
Vitamin A tritt in mehreren Formen auf
Der Begriff Vitamin A steht für eine Reihe von natürlichen und synthetischen Kohlenwasserstoffen, die zu den sogenannten „Diterpenen“ gehören.
Die Verbindungen bestehen aus einer Kohlenstoffkette, an deren Ende eine Sechserring aus Kohlenstoff-Atomen angelagert ist, der als „ß-Jononring“ bezeichnet wird. Die künstlich hergestellten Retinoide sind dem Vitamin A sehr ähnlich. Ihre medizinische Verwendung ist jedoch umstritten.
Die wichtigsten Formen des aktiven Vitamins A sind Retinol, Retinylester und Retinal.
Retinol und Retinal
Retinol oder Vitamin A1 ist ein essenzielles Vitamin und ein einwertiger, primärer Alkohol (Endung: -ol). Da Retinol toxisch ist, wird es vom Organismus an ein Protein gebunden, das Retinol-Bindeprotein (RBP). Damit wird der eigentliche Vitamin-A-Stoffwechsel primär durch dieses Bindeprotein gesteuert.
Nur durch die Bindung wird das Vitamin A biologisch verwertbar. Ein Mangel an RBP resultiert in ähnlichen Symptomen wie eine Hypovitaminose. Überschüssiges Retinol, das nicht an RBP gebunden werden kann, führt zu Vergiftungserscheinungen.
Retinol-Supplementationen sind einer Studie zufolge eine wirksame Vorbeugung gegen Lungenkrebs. Die Dosierung muss dann aber mindestens 1,5 mg täglich betragen.
Kleinere Mengen haben hier keine Auswirkungen. Eine Arbeit, die Vitamin A sogar als Ursache für Lungenkrebs proklamierten, spricht von extremen Überdosierungen. In dieser CARET-Studie, die das pauschale Vorurteil gegen Vitamin A heraufbeschwor, wurde die Wirkung von 30 mg beta-Carotin plus 25000 I.E. (7,5 mg) Retinyl-Palmitat untersucht.
Retinal ist ein Aldehyd (Endung: -al) des Vitamins A.
Die Lichtwahrnehmung durch Retinal
Retinal verbindet sich mit dem Protein Opsin in den Stäbchen der Netzhaut, was als Sehpurpur oder Rhodopsin bezeichnet wird. Retinal liegt nun in der 11-cis-Retinal- Konfiguration vor.
In dieser Form kann der Komplex Licht absorbieren und für die Sehzellen wahrnehmbar machen.
Einfallendes Licht bedingt eine molekulare Veränderung dieser Konfiguration, bei der 11-cis-Retinal zu all-trans-Retinal transformiert. Dadurch verändert sich auch die Gestalt des Opsins, wodurch der Lichtreiz wahrgenommen, dass heißt, ans Gehirn weitergeleitet werden kann.
Ein Mangel an Retinol (in der Form des Retinals) hat eine verminderte Nachtsicht zur Folge; ein verstärkter Mangel führt zu Nachtblindheit, Ermüdung der Augen und Verhornung der Sehzellen.
Retinsäure
Die Retinsäure und ihr Salz, das Retinat, sind wichtige Wachstumsfaktoren für Nervenzellen, besonders während der Embryonalentwicklung. Sie sind beteiligt an der Formierung der Längsachse des Embryos, wobei die Nervenzellen entlang des Konzentrationsgradienten der Retinsäure wandern.
Zu hohe oder zu niedrige Konzentrationen können hier zu Fehlbildungen führen. Weitere wichtige Zielorgane und –gewebe während der Embryogenese sind Epithel-, Zahn-, Knochen-, Plazenta- und Embryonalgewebe.
Eine vollständige Entwicklung von Haut, Haaren, Schleimhäuten, Augen, Lymphgefäßen, Knochen, Geschlechtszellen und Zähnen ist ohne Vitamin A nicht denkbar.
Neben dem Wachstum nimmt die Retinsäure auch Einfluss auf die Zelldifferenzierung. Sie blockiert das Wachstum neoplastischer Zellen („Krebs“) und differenziert sie gleichzeitig zu normalen Zellen, besonders im Bereich der Haut und Schleimhäute.
Hier sorgt sie für ein normales Zellwachstum, was sich ausdehnt auf die Wände der Verdauungs-, Atem- und Harnwege. Es verhindert DNS-Schäden in Hautzellen, bzw. repariert bereits erfolgte Schäden. Sie ist wichtig für eine gesunde Hautfunktion, wie z.B. eine optimale Zellteilung der Keratinozyten.
In sehr geringen Mengen entsteht im Körper aus Retinal auch die all-trans-Retinsäure 13-cis-Retinsäure. Als Tretinoin und Isotretinoin werden diese Verbindung in Salben gegen Hautentzündungen verwendet.
Retinylester
Die Speicherform des Vitamins A ist der Retinylester. Besonders hohe Konzentrationen sind zu finden in Leber, Lunge, Hoden und Retina. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass Retinol bzw. Retinylester in hohen Konzentrationen toxisch sind.
Deswegen verzehren die Inuit angeblich auch keine Eisbärenleber, da diese extrem hohe Vitamin-A-Konzentrationen aufweist.
3-Dehydroretinol
3-Dehydroretinol wird als Vitamin A2 bezeichnet, das ebenfalls inform der Ester und des Aldehyds vorkommt. Es besitzt im Körper dieselben Funktionen wie Vitamin A, allerdings nur mit einer Effektivität von 30 % der des Vitamins A1.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Bildquelle: 123rf.com – Tatjana Baibakova
Dieser Artikel wurde zuletzt am 14.9.2019 aktualisiert.