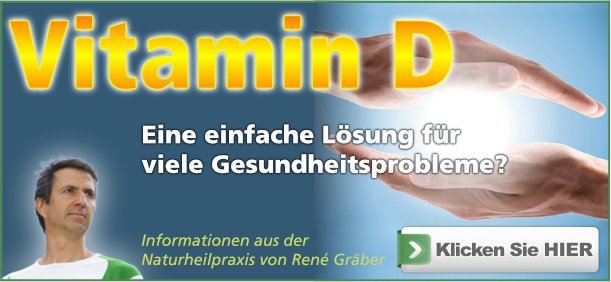Vitamin D – Formen, Vorkommen und Bedarf
In diesem Grundsatzartikel geht es um das Vitamin D. Zunächst einige Fakten, danach die entscheidende Frage: “Wo bekomme ich Vitamin D her?” und dann noch die Fragen zur Unterversorgung und zur angeblichen “Überversorgung”.
Hauptaufgabe des Vitamins D ist die Regulierung des Calcium- und Phosphat-Spiegels. Damit hat der Vitalstoff wichtige Funktionen für den Knochenaufbau.
Vitamin D3 (Cholecalciferol) ist die Form des Vitamins D, das in allen nicht-pflanzlichen Eukaryonten wie dem Menschen physiologisch präsent ist. Im Körper hat es die Funktion eines Prohormons, das über eine Zwischenstufe in das Hormon Calcitriol umgewandelt wird. Im Allgemeinen versteht man unter Vitamin D das Vitamin D3. Dieser Begrifflichkeit wollen wir auch hier folgen.
Die Aktivierung von Vitamin D3 erfolgt in der Leber und den Nieren.
Seit Neuestem weiß man aber auch, dass das Vitamin in anderen Geweben aktiv autokrine Funktionen hat, die Zelldifferenzierung, Apoptose (Programmierter Zelltod), Immunmodulation und Kontrolle hormonaler Systeme einschließen. Nachgewiesen ist auch, dass Vitamin D vermittels des Calcium-Haushaltes die Zellproliferation (Wachstum und Teilung) hemmt. Damit wird eine Zellentartung und mithin Krebserkrankungen unwahrscheinlicher.
Vitamin D ist daher für alle Organe und Organsysteme von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören das Immun- und Nervensystem, Herz, Kreislauf sowie Knochen und Muskeln. Der Vitalstoff hilft, Diabetes zu vermeiden und zu lindern, die Fertilität zu steigern sowie Früh- und Fehlgeburten zu vermeiden.
Mögliche Symptome einer Unterversorgung
Die Folgen einer Mangelversorgung sind daher vielfältig. Eine noch diskrete Unterversorgung hat zunächst eine allgemeine Schwäche und Leistungsabfall, Kopfschmerzen und Konzentrations-Probleme zur Folge. Das klassische Syndrom der regelrechten Hypovitaminose ist die Rachitis bei Kindern.
Zunächst leiden sie als Babys ab dem dritten Monat an Gedeihstörungen, Nervosität, Hitzewallungen und einer typischen Glatze am Hinterkopf. Im vierten Monat leiden die Kleinen an Muskelschwäche und einem aufgetriebenen Bauch („Froschbauch“).
Zuerst am Schädelknochen tritt dann eine Knochenerweichung (Kraniotabes) auf und der zu niedrige Calcium-Spiegel verursacht Muskelkrämpfe.
Der Kopf verformt sich zu einem annähernd quadratischen Schädel (Caput quadratum) und an den Rippen wölben sich Verdickungen hervor. Die Beinknochen können nicht gerade wachsen, sondern verbiegen sich zu „O-Beinen“. Auch die Zahnentwicklung verläuft nicht regulär.
Vitamin-D-Mangel bei Erwachsenen
Wird der Normwert des Vitamins von 30 µg/l im Blutserum, bezogen auf ein Körpergewicht von 70 kg unterschritten, nimmt der Darm zu wenig Calcium auf. Bei Erwachsenen führt dies zu verringerter Calcium-Aufnahme und reduzierter Knochendichte (Osteomalazie) mit der Folge eines gesteigerten Fraktur-Risikos. Eine weitere Konsequenz der beeinträchtigten Knochen ist Muskelschwäche. Nach langjährigem, unbehandeltem Verlauf der Hypovitaminose können sich auch die Beine verkrümmen.
Das RKI geht erst ab einem Wert von unter 12 µg/l von einem Vitamin-D3-Mangel aus. Doch der für die Knochengesundheit optimale Blutserum-Gehalt wird auf 20 µg/l festgelegt. Eine Blut-Konzentration zwischen 30 und 50 µg/l soll angeblich keine zusätzlichen Vorteile für die Gesundheit haben. Diese Meinung ist jedoch nicht mehr aktuell, wie neuere Studien belegen. Angemessen erscheint heute ein Wert von 60 bis 80 µg/l.
Der Vitaminmangel ist aber nicht nur für die Knochen bedrohlich. Die Unterversorgung beutet auch ein erhöhtes Risiko für Autoimmunerkrankungen (Multiple Sklerose, Morbus Crohn, Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2, Systemischen Lupus erythematodes etc.), Infektionen der Atemwege, Hypertonie, Osteopenie und Osteoporose, kardiovaskuläre Erkrankungen, psychische Beschwerden wie Depressionen sowie für das metabolische Syndrom, allgemein erhöhte Sterblichkeit, Muskelschwäche und Fibromyalgie.
Auffällig ist auch das höhere Auftreten einiger Krebsformen in nördlichen Breitengraden. Dies betrifft Tumore im Dickdarm, Brust, Prostata und Eierstöcken sowie das Hodgkin-Lymphom. Parallel dazu ist nachgewiesen, dass unterhalb eines Spiegels von 20 µg/l Vitamin D das Risiko für Dickdarm-, Brust- und Prostata-Krebs um bis zu 50 % erhöht ist. Bei weniger als 12 µg/l Vitamin D ist bei Frauen die Wahrscheinlichkeit, an Dick- und Enddarmkrebs zu erkranken sogar um über 250 % höher als bei normgerechter Versorgung mit dem Vitalstoff.
In einer Studie untersuchten Wissenschaftler der Universität California in San Diego den Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Versorgung und der Entstehung des Kolorektalen Karzinoms. Dabei erhielten die Forscher Satelliten-gestützte Daten über die globale UVB-Strahlung von der NASA und glichen sie mit der Inzidenz des Darmkrebses in 186 Ländern ab. Um andere Faktoren auszuschließen, wurden Ozon-Konzentrationen, Haut-Pigmentierung und die Lebenserwartung in den untersuchten Nationen mit einbezogen.
Im Ergebnis zeigte sich, dass in Ländern mit intensiveren UVB-Werten Darmkrebs seltener vorkommt als in nördlichen Regionen. Besonders deutlich war der Effekt bei älteren Menschen. Die Studie legt eine präventive Wirkung von Vitamin D3 gegen Darmkrebs nahe.
Einer deutschen Studie mit 10.000 Teilnehmern zufolge erhöht sich bei einem niedrigen Vitamin-D-Gehalt die Gefahr, an Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen zu sterben, deutlich.
Supplementationen mit Vitamin D oberhalb von 400 i.E. (0,01 mg), deutlicher noch bei über 600 I.E. (0,015 mg), reduzieren das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken um rund die Hälfte.
Eine finnische Langzeitstudie belegt auch den Zusammenhang zwischen Vitamin D und Diabetes. Die Untersuchung zeigt, wie eine Supplementierung von 2.000 I.E. Vitamin D im ersten Lebensjahr eine spätere Erkrankung an der Stoffwechselstörung verhindern kann. In 30 Folgejahren war die Inzidenz von Diabetes Typ 1 um 80 % niedriger als ohne die Vitalstoffgabe. Eine andere Studie belegt, dass 800 I.E. Vitamin D einen Diabetes Typ 2 um ein Drittel unwahrscheinlicher machen, als dies bei einer Gabe von nur 400 I.E. der Fall ist.
Formen und Synthese des Vitamin D:
- Vitamin D1 – Verbindung von Ergocalciferol (D2) und Lumisterol
- Vitamin D2 – Calciferol, bzw. Ergocalciferol
- Vitamin D3 – Cholecalciferol
- Vitamin D4 – 22,23-Dihydroergocalciferol, die gesättigte Form von D2
- Vitamin D5 – Sitocalciferol.
- Vitamin D6
- Vitamin D7
Vitamin D3 ist die biogene, beziehungsweise physiologisch nutzbare Form des Vitalstoffs. Außer Vitamin D2 sind die anderen Varianten ausschließlich künstlichen Ursprungs, was bei Supplementationen berücksichtigt werden muss. In der EU enthalten solche Präparate in aller Regel Vitamin D3. Bei ausländischen Mitteln ist dies jedoch nicht durchgängig der Fall. So wird in den USA auch Vitamin D2 verwendet.
Zwar kann der Stoffwechsel daraus Vitamin D3 herstellen, aber der Prozess ist nicht effektiv genug, um den Bedarf zu decken. Das zeigte eine Studie der University of Surrey, die am 5. Juli 2017 auf EurekAlert veröffentlicht wurde. Im Zuge der Untersuchung wollten die Forscher feststellen, inwieweit Vitamin D2 dem Vitamin D3 ebenbürtig ist. 335 Frauen stellten sich als Versuchspersonen zur Verfügung.
Dann teilten die Wissenschaftler fünf Gruppen ein: Zwei Gruppen erhielten Vitamin D3 inform von Saft beziehungsweise Keksen. Zwei weitere Gruppen bekamen Vitamin D2 als Saft oder als Gebäck. Die fünfte Gruppe nahm zur Kontrolle ein Placebo ein. Unter Vitamin-D3-Supplementation stieg der Serum-Spiegel des Vitalstoffs um rund 75 % an, während Vitamin D2 nur zu einem um 33 % höheren Vitamin-D3-Wert führte.
Die Teilnehmerinnen der Placebo-Gruppe erlitten einen Abfall des Blutwertes um 25 %. Die Ergebnisse passen zu einer älteren Studie von Dr. Robert P. Heaney und seinem Team, die schon am 1. März 2011 im Journal of Clincal Endocrinology & Metabolism publiziert wurde. Hier kommen die Forscher zu dem Schluss, dass Vitamin D2 zur Prophylaxe von Osteoporose und Herzkrankheiten kaum geeignet ist.
Der größte Teil des Vitamin-D-Bedarfs wird durch Sonnenbestrahlung gedeckt. Das gilt aber nur unter günstigen Bedingungen wie in der warmen Jahreszeit und Insolations-reichen Regionen. In der Mittagszeit (12:00 bis 13:00 Uhr) ist die Haut-Resorption der UV-B-Strahlung am höchsten.
Zudem ist die biologische Nutzung der energiereichen Wellen vom Haut-Typ abhängig. US-Forscher haben festgestellt, dass ein Mensch mit dem Haut-Typ III in Miami im Juli um 12:00 Uhr ein Viertel seiner Hautoberfläche 3 Minuten lang der Sonne aussetzen muss, um 400 IE Vitamin D3 zu produzieren.
Für eine Dosis von 1.000 I.E. sind 6 Minuten erforderlich. Noch längere Expositions-Zeiten sind in weiter nördlich gelegenen Regionen nötig. Wie viel Sonneneinstrahlung jeder Mensch unter welchen Bedingungen braucht, ist kaum genau zu definieren. Denn es hängt von vielen Faktoren ab, wieviel Vitamin D3 ein Mensch braucht, beziehungsweise aufnehmen und verwerten kann.
Deswegen plädieren die Wissenschaftler für Ergänzungs-Präparate mit Vitamin D3. In den nördlichen Zonen der Erde ist bei der Mehrheit der Menschen nach dem Winter ein Vitamin-D-Mangel feststellbar. Das betrifft Milliarden von Menschen, wobei die Bewohner von Pflegeheimen besonders betroffen sind. Sogar im Sommer können Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor die Eigensynthese blockieren, weil zu wenig UV-B-Strahlung die Haut erreicht.
Die Folgen von zu wenig Sonne für den Knochenbau zeigt eine Studie, die sich mit der Häufigkeit des Oberschenkelhalsbruches in verschiedenen Klimazonen befasst. Demnach beträgt die Inzidenz dieses Ereignisses in Singapur nur einem Zehntel des Wertes von Oslo und Schweden.
Wegen der Möglichkeit zur Eigen-Synthese des Körpers ist Vitamin D per Definition eigentlich kein Vitamin. Diese definieren sich als Substanzen, die vom Körper nicht selbst hergestellt werden können, die aber essenziell für sein Funktionieren sind.
Die Vorstufen des Vitamin D werden indes vom Körper selbst produziert (Provitamin 7-Dehydrocholesterol). Die Bezeichnung „Vitamin“ hat eher historische Gründe.
Da die Substanz endogen synthetisiert wird und da ihre Wirkung sich nicht nur auf den Syntheseort beschränkt, sondern andere Gewebe ebenfalls umfasst, hat sie mehr den Charakter eines Prohormons.
In der Haut des Menschen ist 7-Dehydrocholesterol in ausreichend hoher Konzentration im Stratum spinosum und basale vorhanden. Durch einfallendes UV-Licht entsteht eine photochemische Reaktion, in deren Verlauf Prävitamin D3 entsteht.
Über Zwischenschritte entsteht Vitamin D3, das im Blut an das Vitamin-D-bindende Protein gekoppelt und zur Leber geführt wird. Dort wird es zu 25(OH)Vitamin D3 hydroxyliert.
Da hohe Konzentrationen an Cholecalciferol toxisch sind, muss der Körper sich vor einer extensiven Produktion schützen, indem er vermehrt Melanin bildet, das in der Lage ist, UV-Strahlung zu resorbieren. Es kommt zu dem Bräunungseffekt durch Sonneneinstrahlung.
Der 7-Dehydrocholesterolgehalt nimmt mit zunehmendem Alter ab, ebenso die Fähigkeit, Vitamin D3 zu bilden. Diese Fähigkeit sinkt auf ca. ein Drittel eines 20-Jährigen.
Es bedarf in der Regel nur einer kurzen, intensiven Sonnenbestrahlung der Haut mit hohem UV-B-Anteil, um eine mehr als ausreichende Menge an Vitamin D3 zu erzeugen.
Etwa 12 Minuten sind ausreichend für einen jungen, hellhäutigen Menschen, um 250 bis 500 Mikrogramm (µg) (10.000 – 20.000 I.E.) zu produzieren. Die tägliche Erhaltungsdosis liegt bei 200 bis 500 I.E. Dunkelhäutige Menschen benötigen für den gleichen Effekt eine Bestrahlung von zwei Stunden.
Falls Sie sich noch immer die Frage stellen: Welches Vitamin D Präparat ist denn das Beste? So schauen Sie mal in meinen Beitrag: Vitamin D Präparate im Test.
Und bevor ich es vergesse: Wie Sie die volle “Wirkung” von Vitamin D entfalten, beschreibe ich in meinem Büchlein dazu: Vitamin D – Eine einfache Lösung für viele Gesundheitsprobleme.
Funktion und Aufgaben im Körper
Nach seiner Hydroxylierung in der Leber zu Calcidiol (25(OH)Vitamin D3) wird das Vitamin wieder an das Vitamin-D-bindende Protein gebunden und zurück in den Blutkreislauf geschickt.
Es hat die Funktion eines Vitamin-D-Speichers, der notwendig ist, um Produktionsspitzen und –pausen abzupuffern. Gelangt es ins Zielgewebe, wird es zu Calcitriol aktiviert, welches den eigentlich aktivierenden Liganden für den Vitamin-D-Rezeptor darstellt.
Calcitriol wirkt in den Zellen der Zielorgane wie ein Steroidhormon. Dort wird es an ein intrazelluläres Rezeptorprotein gebunden und von dort in den Zellkern transportiert. Im Zellkern kommt es zu einer Assoziation von Vitamin-Rezeptor-Komplex mit der DNA, was die Transkription von hormonsensitiven Genen beeinflusst.
Vitamin D ist in einem Regelkreis zwischen Knochen, Nieren und Schilddrüse eingebunden. In diesem Rahmen sorgt das Steroid für eine dem Bedarf angemessene Konzentration von Calcium und Phosphat.
Bei einem Mangel an Phosphat signalisiert Vitamin D der Niere, die Ausscheidung des Minerals zu drosseln. Der Weg dieser Reizübertragung geht über die Nebenschilddrüse. Diese Hormondrüse schüttet weniger Parathormon aus, das die Rückresorption von Phosphat hemmt.
Daraufhin steigt der Phosphat-Spiegel an. Gleichzeitig sinkt die Calcium-Konzentration, weil das Parathormon dessen Rückresorption in der Niere fördert.
Umgekehrt bewirkt eine Erhöhung der Parathormon-Ausschüttung einen Anstieg der Calcium- und eine Erniedrigung der Phosphat-Konzentration.
Bei hohem Calcium-Spiegel sezerniert die Schilddrüse Calcitonin. Dieses Hormon bewirkt den Einbau des Erdalkalimetalls in die Knochen. Sinkt die Calcium-Konzentration daraufhin zu stark ab, setzten die Nieren aktives Vitamin D frei, wodurch die Resorption von Calcium im Darm gesteigert wird.
Über den Zusammenhang und die Bedeutung von Vitamin D und Magnesium berichte ich hier: Vitamin D und Magnesium
Weil zur Aktivierung von Vitamin D Magnesium erforderlich ist, sollte auf die optimale Versorgung mit dem Mineral geachtet werden.
Schützt Vitamin D vor Erkältungen?
Viele Jahre galt die Auffassung, dass Vitamin C die beste Vorsorge gegen Erkältung und Co sei. Neuere Erkenntnisse der Forschung haben diese lang angenommene Theorie jedoch widerlegt und sehen das Vitamin D durchaus als effektiv an.
Wie US-amerikanische Mediziner unter der Leitung von Dr. Adit Ginde von der University of Colorado in Denver herausgefunden hatten, sinkt die Wahrscheinlichkeit, an einem grippalen Infekt zu erkranken, bei ausreichender Menge von Vitamin D im Blut. Zu diesem Zweck wurde der Vitamin D Gehalt von 19.000 Testpersonen untersucht.
Diese Studie ergab, dass die Erkältungswahrscheinlichkeit von Personen mit geringer Menge Vitamin D im Blut bis zu 40 Prozent höher war als bei den Probanden mit ausreichendem Vitamin D Gehalt. Demnach stärkt ein optimaler Vitamin-D-Wert das Immunsystem. Man darf gespannt sein, ob weitere klinische Tests das Ergebnis der Studie bewahrheiten können.
Im Zusammenhang mit der Corona-Krise im Jahr 2020 rückte auch das Vitamin D diesbezüglich in den Blickpunkt. In meinen Beiträgen:
hatte ich ausführlich Stellung dazu genommen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter “Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.” dazu an:
Nahrungsaufnahme und Bedarf
Bisherige Empfehlungen zur Vitamin-D-Aufnahme waren aufgrund eines statistischen Fehlers viel zu niedrig angesetzt. Daher ist in vielen Darstellungen noch ein veralteter Tagesbedarf angegeben.
Infolge des Fehlers sollten heute zehnmal höhere Werte gelten als früher. Darauf wiesen die Entdecker des Irrtums schon 2014 hin (Dr. Garland von der University California/San Diego und Dr. Heaney von der Creighton University in Omaha/Nebraska).
Demnach beläuft sich der Tagesbedarf an Vitamin D3 für einen durchschnittlichen Erwachsenen und Kinder auf 7.000 I.E. (Internationale Einheit). Das entspricht 175 µg Vitamin D3. In dieser Menge sind alle Quellen des Vitalstoffs enthalten, also die Eigen-Produktion in der Haut, Nahrungsmittel und eventuelle Supplementationen.
Wenn der Vitamin-D-Spiegel unter 20 µg/l abgesunken ist, sollte für 2 Monate eine Supplementierung von 20.000 I.E pro Woche erfolgen. Ist die Konzentration danach auf nur 30 µg/l gestiegen, wird die Therapie noch weitere 2 Monate fortgesetzt.
Oft liegt dann ein Mangel an Sonnenlicht zugrunde, sodass diese Supplementierung auf Dauer beibehalten werden soll. Die tägliche Dosis sollte nicht höher sein als 9.000 I.E. täglich.
Denn die körpereigene Vitamin-D-Synthese reicht für die Sicherstellung der Versorgung nicht immer aus, auch wenn der Körper auf den gespeicherten Vitalstoff zurückgreifen kann.
Vitamin D3 ist primär enthalten in Fettfischen, Innereien, Eiern und Milchprodukten. 100 g Sardinen liefern rund 10 µg und dieselbe Menge Forelle 22 µg. Die einzige bisher bekannte pflanzliche Quelle ist Goldhafer (Trisetum flavescens), der gemeinhin nur als Tierfutter verwendet wird.
1 Hühnerei beinhaltet 3 µg Vitamin D. Diese Lebensmittel enthalten auch genügend Fett, das zur Resorption des fettlöslichen Vitamins benötigt wird.
Vitamin D2 ist in Pilzen enthalten und wahrscheinlich auch in einigen grünen Pflanzen. Für die Versorgung mit dem daraus entstehenden Vitamin D3 spielen diese Quellen aber praktisch keine Rolle.
Wo bekomme ich mein Vitamin D her?
Vier Varianten der optimalen Versorgung mit Vitamin D
1. Sonne tanken
Wenn die Sonne bei klarem Wetter mehr als 45 Grad hoch am Himmel steht, sendet sie uns so viel UV-B-Strahlung, dass unser Körper über die unbedeckte Haut selbst große Mengen des so wichtigen Vitamin D produzieren kann. Bei flach stehender Sonne ist der Weg der Sonnenstrahlen durch die dämpfende Atmosphäre so groß, dass gerade die UV-B-Anteile des Frequenzspektrums immer stärker gefiltert werden.
Bedingt durch diese Gründe ist eine körpereigene Vitamin-D-Produktion in Mitteleuropa in den Monaten von Oktober bis März praktisch unmöglich.
Der oben erwähnte 45-Grad-Winkel ist allerdings nicht als starre Grenze zu verstehen, sondern ein sehr weicher, kontinuierlicher Durchgang, der sich zum Beispiel durch eine längere Exposition in gewissem Rahmen ausgleichen lässt. An einem wolkenlosen Sommertag kann die Sonne um die Mittagszeit, je nach Hauttyp, innerhalb eines Zeitraums von fünf bis 30 Minuten, zu einer Produktion von mehr als 15.000 Einheiten Vitamin D führen.
Bitte beachten Sie dabei:
- Sonnenbrand unbedingt vermeiden: Helle Hauttypen sollten sich mit kürzeren Expositionszeiten in der Sonne zufriedengeben. Sie produzieren trotzdem genügend Vitamin D.
- Sonnencreme oder Sonnenöl sind kontraproduktiv: Dadurch gelangt kaum noch UV-B-Strahlung in die oberen Hautschichten und eine Vitamin-D-Produktion wird damit fast vollständig unterbunden.
2. Vitamin-D-Versorgung durch Nahrungsmittel
Auch mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährungsweise ist eine ausreichende Versorgung des Körpers mit Vitamin D, die Rede ist hier von ungefähr 3.000 Einheiten pro Tag, leider nicht garantiert. Die wenigen Produkte mit nennenswerten Mengen an Vitamin D wie zum Beispiel Leber sind meistens mit toxischen Stoffen belastet.
3. Besuche des Sonnenstudios
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sonnenstudios verfügen leider nur über ein begrenztes Wissen über die Resilienz unserer Haut in Abhängigkeit vom Hauttyp gegenüber ultravioletter Strahlung, das heißt, die Beratung, die Sie dort bekommen können, ist oftmals nicht nur lückenhaft, sondern sogar falsch. Und das kann gefährlich werden. Bei zu häufiger und zu langer Verweildauer auf einer Sonnenbank kann es durchaus zu Hautkrebs kommen. Dabei ist der geringe Anteil der von Solarienröhren emittierten UV-B-Strahlen hinreichend für eine erforderliche Eigenproduktion in der Haut.
4. Hochdosierte Vitamin-D-Präparate
Ich rate meinen Patienten dazu, im Winterhalbjahr zwischen Oktober und April 2.000 I.E. (Internationale Einheiten) eines gut bewährten Vitamin-D-Präparats einzunehmen. Meine eigene Wahl fällt dabei auf „Vitamin D3K2 Öl von Dr. Jacobs“ zum Preis von etwa 20 Euro. Die Kombination mit Vitamin K2 ist deswegen sinnvoll, weil auch dieser Vitalstoff für den Calcium-Haushalt wichtig ist. Bereits ein Tropfen davon enthält circa 800 I.E. Das Mittel bekommen Sie in der Apotheke, im Reformhaus oder im Internet. Die maximal zulässige Tagesdosis einer Supplementation wird auf 8.000 I.E. geschätzt.
Eine tägliche Vitamin-D3-Zufuhr bis zu 50 µg (2.000 I.E.) gilt heute als sicher. Grundlage dieser Annahme ist eine Arbeit, die sich mit über 100 wissenschaftlichen Studien zu den Themen „Bedarf“, Supplementation“ und „Wirkung“ von Vitamin B3 befasst (Vitamin D Supplementation: A Review of the Evidence Arguing for a Daily Dose of 2000 International Units (50 µg) of Vitamin D for Adults in the General Population, Pludowski et al., Open Access Journals, 29 Januar 2024).
Die Autoren raten sogar zu einer Supplementation von 2.000 I.E. für die Mehrheit der Erwachsenen. Nur so kann ein Vitamin-D3-Serumspiegel von etwas über 30 µg/l erreicht werden, der nach den gesammelten Erkenntnissen für optimal gehalten wird. Diese Dosierung führt mit Sicherheit auch bei den Menschen zu einer guten Versorgung mit dem Vitalstoff, die aufgrund von Alter, Krankheit, Haut-Typ oder Übergewicht zu einem D3-Mangel neigen.
Ein Risiko der Überdosierung besteht bei dieser Menge nicht. Der ausreichende Sicherheitsabstand zur riskanten Zufuhr ab 3.200 I.E. pro Tag wird so gewahrt. Denn erst ab dieser Menge können eine Hyperkalzämie auftreten sowie eine erhöhte Sturzgefahr bestehen.
Die gesichteten Einzel-Studien belegen die gesundheitlichen Vorteile des Zielwertes von 30 µg/l im Blutserum. Das geringste Mortalitäts-Risiko besteht bei einem Blutwert von 31 µg/l. Ergebnisse aus Studien weisen sogar darauf hin, dass eine Serum-Konzentration von rund 40 µg/l Diabetes Typ 2 und Krebs verhindern hilft. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Blutgehalt von 50 µg/l, ab dem eine Hyperkalzämie zu erwarten wäre.
Hypovitaminose – Unterversorgung
Eine Mangelversorgung bedingt Rachitis bei Kindern und Osteomalazie bei Erwachsenen.
Bei Serumkonzentrationen unter 30 µg/l besteht ein Mangel an Vitamin D3. Dann versucht der Organismus, dies durch Erhöhung des Parathormonspiegels zu kompensieren. Andere mögliche systemische Auswirkungen eines Vitamin-D3-Mangels sind eingangs erörtert worden.
Hypovitaminosen kommen auch bei Resorptions-Störungen des Darmes vor, wenn gleichzeitig zu wenig UV-Exposition erfolgt. Einige Medikamente wie Antiepileptika (Carbamazepin) und Magensäureblocker können die Aufnahme des Vitalstoffes hemmen und so ein Defizit auslösen. Anfällig für die Hypovitaminose sind auch übergewichtige Menschen.
Ursache können daneben Leber- und Nieren-Funktions-Störungen sein, bei denen die Aktivierung von Vitamin D3 nicht mehr in ausreichendem Maße stattfindet. Mangel-Symptome entstehen auch bei erblich bedingen Krankheiten, die dazu führen, dass der Körper die Vitamin-D3-Signale nicht erkennen kann.
Dann liegt zwar genügend Vitamin D3 vor, ist aber für den Körper nutzlos. Der Arzt hat nach einem Gespräch mit dem Patienten einen ersten Verdacht. Bildgebende Verfahren geben Aufschluss über den Zustand des Skelettes und durch eine Blutuntersuchung wird der Vitamin-D-Spiegel ermittelt.
Dann stellt sich die Frage, ob und welche Erkrankungen die Hypovitaminose verursacht hat, oder ob zu wenig Sonnenlicht oder falsche Ernährung vorliegen. Als Soforthilfe erhält der Patient Vitamin-D-Präparate, aber auch Calcium- und Phosphat-Supplementationen.
Etwaige Erkrankungen des Darmes, der Leber oder Nieren müssen behandelt werden. Bei Kleinkindern ist eine prophylaktische Gabe des Vitalstoffes zu erwägen. Dasselbe gilt für Frauen jenseits der Wechseljahre.
Hypervitaminose – Überversorgung
Oder: Ist zu viel Vitamin D schädlich?
Dosierungen von täglich über 80 µg bei (entspricht 3.200 I.E. können innerhalb von 6 Monaten zu einem erhöhten Calcium-Spiegel (Hyperkalzämie) führen. Dadurch sind die Nieren überfordert und es droht ein akutes Nierenversagen.
Die Patienten sind kraftlos, psychisch verändert und leiden starken Durst sowie quälendes Jucken. Hinzu kommen Herzrasen, Herz-Rhythmus-Störungen und Muskelschwäche. Die Kranken können sogar ins Koma fallen, ein Fünftel dieser Menschen verstirbt daran.
Lebensmittel oder Sonnenlicht können dies nicht auslösen. Die Vitamin-D-Hypervitaminose ist immer durch übertriebene Supplementierungen bedingt, die sofort zu unterbinden sind. Allerdings darf ich hinzufügen, dass diese Symptome extrem selten sind und man schon sehr viel Vitamin D über mehrere Monate zuführen müsste, um dorthin zu gelangen.
In meinem Beitrag “Die zwei Vitamin D Probleme” gehe ich darauf etwas näher ein.
Im Beitrag: Vitamin D bei Brustkrebs komme ich zum Schluss: “Es gibt kein giftiges Vitamin D.” Seine Giftigkeit (seitens der Drohmedizin) besteht in der Theorie in Dosierungen weit jenseits der 100 µg/l – Grenze, die praktisch nicht zu verwirklichen sind; in der Praxis jedoch in Dosierungen von weit unterhalb der 50 Nanogramm Grenze, die sich als ein signifikant erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen äußern.
Sogar die einmalige Gabe von 300.000 I.E. hatte bisher nie zu Komplikationen geführt. Lediglich Blutwerte oberhalb von 150 µg/l führen zu den klassischen Symptomen eines gefährlich erhöhten Calcium- und Phosphat-Spiegels, die Nierensteine oder eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse zur Folge haben kann.
Im Symptome.ch Forum gibt es bereits eine Diskussion zum Thema: Vitamin D – Erfahrungen | Symptome, Ursachen von Krankheiten
Fazit
Zum Vitamin D geistern extrem viele Halbwahrheiten herum. Jeder scheint etwas anderes zu erzählen. Und die Warnungen vor dem Vitamin D sind auch reichlich vorhanden. Auf diese “Warnungen” gehe ich in folgenden Beiträgen ausführlicher ein, die Sie sich unbedingt ansehen sollten:
Laut Robert-Koch-Institut sind 30 % der Deutschen mit Vitamin D unterversorgt. Im Hinblick auf die gesundheitliche Bedeutung des Vitalstoffes müsste hier dringend gegengesteuert werden. Aktuelle Erkenntnisse sprechen für eine Supplementierung von 2.000 I.E. Vitamin D3 täglich – mehr aber auch nicht. Es sei denn, die Blutwerte sinken dauerhaft unter 30 µg/l. Sollte es tatsächlich noch Supplemente oder Anreicherungen mit Vitamin D2 geben, kann man darauf getrost verzichten. Denn diese Form hat bestenfalls nur die halbe Wirkung.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den “5 Wundermitteln” an:
Kleine Anmerkung: Die Sache mit den “5 Wundermitteln” ist mit Abstand der beliebteste Newsletter, den meine Patienten gerne lesen…
Dieser Beitrag wurde letztmalig am 02.06.2024 aktualisiert.