Natürliches Lithium: Was Lithiumorotat so besonders macht
Es gibt Stoffe, über die spricht man nicht gern. Lithium gehört dazu. Zu viele Ärzte denken bei dem Wort reflexhaft an bipolare Störungen, Vergiftungsgefahr und regelmäßige Blutspiegelkontrollen. Doch was, wenn genau dieses Element – richtig dosiert und in der passenden Form – nicht nur für seelische Stabilität sorgt, sondern auch das Gehirn schützt, Entzündungen lindert und sogar die Zellreinigung ankurbelt?
Lithiumorotat heißt die Variante, die immer wieder durch Fachkreise und Foren geistert – oft als Hoffnungsträger, manchmal als gefährlich verkannt, selten nüchtern betrachtet. Genau das habe ich für diesen Beitrag getan: mit Blick auf die Studienlage, die physiologische Wirkung, die molekularen Mechanismen – und auf das, was wir aus der Naturheilkunde seit Jahrzehnten über Selbstregulation, Entgiftung und Zellschutz wissen.
Es geht nicht um Psychiatrie. Es geht um Neuroprotektion, mentale Resilienz, Autophagie – und um die Frage: Kann ein unterschätztes Spurenelement dabei helfen, unser Gehirn robuster zu machen?
Im Beitrag zeige ich Ihnen, welche Rolle Lithiumorotat dabei spielt – und wie sich seine Wirkung mit Mikronährstoffen, Heilpflanzen, Fasten und Mitochondrienmedizin kombinieren lässt.
Was ist Lithiumorotat?
Lithiumorotat ist das Lithiumsalz der Orotsäure, die eine Zwischenstufe in der Synthese von Nukleotiden darstellt. Befürworter dieser Darreichungsform argumentieren, dass Lithiumorotat effektiver ins Gehirn gelangt als Lithiumcarbonat, sodass geringere Dosen erforderlich sind und weniger Nebenwirkungen auftreten.
Das Klinikum St. Georg [1] gibt an, dass Lithiumorotat in niedrigen Dosen die Serotoninsynthese stimulieren und dadurch antidepressiv wirken kann. Zudem sollen neuroprotektive Effekte vorliegen, was insbesondere bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson oder Multipler Sklerose von Interesse ist. Weitere potenzielle Vorteile umfassen eine Unterstützung des Immunsystems, antivirale Wirkungen bei Herpes simplex sowie positive Effekte auf den Blutzuckerspiegel bei Typ-2-Diabetes. Auch in der Suchttherapie, etwa beim Alkoholentzug, wird Lithiumorotat gelegentlich eingesetzt.
Systemische Wirkung auf das Gehirn
Neuere Erkenntnisse legen nahe, dass Lithium nicht nur stimmungsstabilisierend wirkt, sondern auch eine Schlüsselrolle für die geistige Selbstregulation spielt – also für das, was man als „mentale Resilienz“ oder auch als kognitive Immunabwehr beschreiben könnte. Gemeint ist die Fähigkeit unseres Gehirns, Stress zu verarbeiten, kritisch zu denken, Entscheidungen zu treffen und emotionale Stabilität zu bewahren.
Besonders wichtig ist dabei der Hippocampus, jener Hirnbereich, der für das autobiografische Gedächtnis, die emotionale Verarbeitung und die Neubildung von Nervenzellen zuständig ist. Studien zeigen, dass selbst sehr niedrige Dosen von Lithium die Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus anregen können – ein Effekt, der bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder auch bei Depressionen von hoher Relevanz ist.
Ein Mangel an Lithium – etwa in Regionen mit extrem niedrigen Konzentrationen im Trinkwasser – wird mit einer erhöhten Rate an Depressionen, Suiziden, kognitivem Abbau und impulsivem Verhalten in Verbindung gebracht. Die tägliche Zufuhr über Wasser und Nahrung beträgt in vielen Ländern nur etwa 30 bis 40 Mikrogramm – empfohlen werden jedoch bis zu 1 Milligramm pro Tag, um neurologisch stabilisierende Effekte zu erreichen.
Synergie mit anderen Vitalstoffen
Die Wirkung von Lithium hängt stark vom Gesamtzustand des Stoffwechsels ab. Wer zusätzlich an einem Mangel an Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Zink oder Selen leidet, kann nicht in vollem Umfang von Lithium profitieren. Besonders im Gehirn zeigen sich diese Zusammenhänge deutlich: Entzündungen, mitochondriale Schwäche, chronischer Stress und Vitalstoffmängel wirken hier kumulativ.
Ein integrativer Ansatz kombiniert daher Lithiumorotat mit weiteren Mikronährstoffen – insbesondere Vitamin D3, Omega-3 (EPA/DHA), B-Vitaminen, Zink, Magnesium und Selen. Ziel ist es, die Neuroregeneration zu fördern, entzündliche Prozesse zu bremsen und die neuronale Plastizität zu stärken.
Lithium, Autophagie und zelluläre Erneuerung
Lithium aktiviert über molekulare Schaltstellen wie GSK-3β und IMPase auch die sogenannte Autophagie – die Selbstreinigung und Erneuerung von Zellen. Dies ist der gleiche biologische Prozess, der durch Fasten angeregt wird: alte Zellbestandteile und fehlerhafte Proteine werden abgebaut, die Zellleistung verbessert sich. In Tiermodellen konnte gezeigt werden, dass Lithium diese Mechanismen auf zellulärer Ebene reguliert – insbesondere in Nervenzellen.
Diese zellulären Effekte machen Lithium nicht nur für psychiatrische Krankheitsbilder interessant, sondern auch im Kontext von neurodegenerativen Erkrankungen, Long Covid, altersbedingter Vergesslichkeit oder oxidativem Stress.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen Praxis-Newsletter mit den „5 Wundermitteln“ an:
Ein Pionierblick zurück: Dr. Nieper über Lithiumorotat
Wer Lithiumorotat für eine moderne Entdeckung hält, irrt. Bereits in den 1990er-Jahren sprach der hannoversche Internist und Zellforscher Dr. Hans A. Nieper über die besonderen Eigenschaften dieses Spurenelements – und zwar mit einer Klarheit und Präzision, die ihrer Zeit weit voraus war.
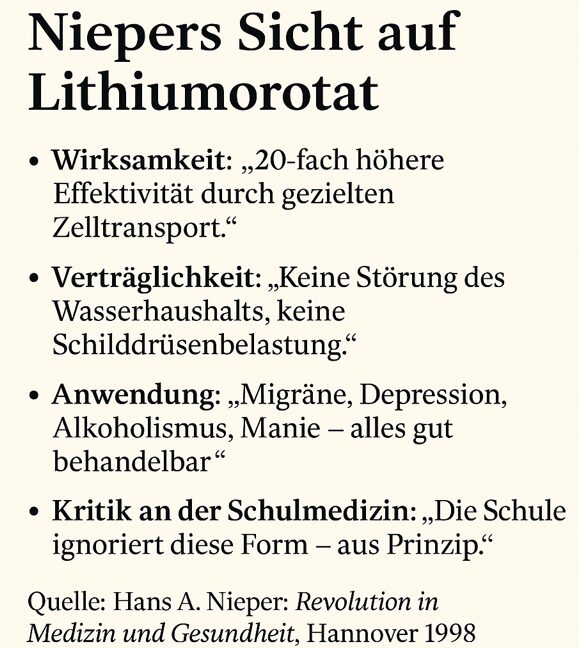
Nieper war kein Unbekannter. Er leitete eine Privatklinik in Hannover, forschte intensiv zur zellulären Mikronährstoffmedizin – und wurde international bekannt, weil er unter anderem den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan bei Krebs behandelte. Seine Therapien galten als unorthodox, aber wirkungsvoll. Und sie basierten auf einem einfachen Prinzip: Bringe Wirkstoffe gezielt dorthin, wo der Körper sie braucht – mit möglichst wenig Belastung.
In seinem Buch „Revolution in Medizin und Gesundheit“ schrieb er:
„Um diese unbefriedigenden Nebenwirkungen [von Lithiumcarbonat] zu überwinden, kann man einen Trick anwenden: Statt der gängigen Salze gibt man das Lithiumsalz der Molkensäure (Lithium-Orotat), welches bevorzugt in jene Zellsysteme wandert, welche man beeinflussen möchte.“
Nieper bezog sich dabei auf Gliazellen im Gehirn, das Reizleitungssystem des Herzens, die Schrittmacherzellen und sogar das Knochenmark. Sein Fazit:
„5 mg Lithium aus Lithium-Orotat sind klinisch etwa so wirksam wie 100 mg Lithium aus Lithiumcarbonat.“
Noch spannender aber ist, dass er schon damals über Stimmungsstabilisierung, Depression, Manie, Migräne und sogar Alkoholismus sprach – also Anwendungen, die heute in Studien nach und nach bestätigt werden. Und doch wurde genau das von der klassischen Medizin ignoriert:
„Dennoch hat die ‚Schule‘ das Lithium-Orotat in der Behandlung des Alkoholismus nicht im Angebot, gleicherweise nicht bei der Behandlung der Manie, der leichten Depression, auch nicht der Migräne, bei der es ebenfalls wirksam ist.“
Ich las das Buch erstmals 1998 und mir war sofort klar, dass Lithiumorotat in der Behandlung genau dieser Probleme eine wichtige Rolle spielt. Und fragte mich damals: Wo bekommt man so etwas her? Damals war Lithiumorotat nahezu nicht erhältlich. Deswegen verlor ich es aus den Augen. Heute ist das anders – auch dank Wissenschaftlern wie Dr. Michael Nehls, der das Thema mit seinem Konzept des mentalen Immunsystems wieder ins Licht gerückt hat.
Wissenschaftliche Untersuchungen zu Lithiumorotat
Unterschiede in der Bioverfügbarkeit
Eine Studie der Universität von Saskatchewan aus dem Jahr 2021 untersuchte, ob Lithiumorotat eine bessere therapeutische Option darstellt als Lithiumcarbonat [2]. Die Autoren stellten fest, dass Lithiumcarbonat aufgrund seiner hohen Dosierung eine Reihe von Nebenwirkungen verursachen kann, darunter Polydipsie (verstärkter Durst), Polyurie (verstärkter Harndrang), Nierenfunktionsstörungen und Schilddrüsenunterfunktion.
Im Vergleich dazu zeigte Lithiumorotat eine schnellere Durchquerung der Blut-Hirn-Schranke, sodass die therapeutisch wirksame Dosis niedriger ist, was wiederum das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen senkt.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Lithiumorotat in der Maniebehandlung
Eine 2023 veröffentlichte Studie derselben Forschungsgruppe verglich Lithiumorotat und Lithiumcarbonat in einem Mausmodell der Manie [3]. Die Forscher fanden heraus, dass 1,5 mg/kg Lithiumorotat eine bessere Wirkung erzielte als 15–20 mg/kg Lithiumcarbonat.
Zudem zeigten die mit Lithiumcarbonat behandelten Tiere Nebenwirkungen wie erhöhten Durst, erhöhte Kreatininwerte bei männlichen Tieren und gesteigerte TSH-Werte bei weiblichen Tieren. Diese Nebenwirkungen traten bei Lithiumorotat nicht auf, was für eine bessere Verträglichkeit spricht.
Historische Forschung zu Lithiumorotat
Bereits 1978 untersuchten Forscher die Lithiumkonzentrationen im Gehirn von Ratten nach Verabreichung von Lithiumorotat oder Lithiumcarbonat [5]. Die Lithiumkonzentrationen waren nach Gabe von Lithiumorotat bis zu dreimal höher als nach Lithiumcarbonat. Die Autoren schlugen vor, dass niedrigere Lithiumorotat-Dosen ausreichen könnten, um therapeutische Effekte im Gehirn zu erzielen, während die Serumspiegel stabil blieben.
Ein Jahr später wurde jedoch eine Arbeit veröffentlicht, die nachteilige Effekte auf die Nierenfunktion von Ratten nach Verabreichung von Lithiumorotat zeigte [4]. Die Forscher stellten eine Abnahme der glomerulären Filtrationsrate fest und folgerten daraus, dass Lithiumorotat nicht für die Behandlung beim Menschen geeignet sei. Kritiker dieser Studie weisen jedoch darauf hin, dass hier gleiche Dosen von Lithiumorotat und Lithiumcarbonat verwendet wurden, obwohl aufgrund der höheren Bioverfügbarkeit von Lithiumorotat eine niedrigere Dosis angemessener gewesen wäre.
Toxikologische Bewertung
Eine 2021 veröffentlichte toxikologische Untersuchung bewertete die Sicherheit von Lithiumorotat [6]. Die Autoren führten verschiedene genotoxische Tests sowie eine 28-tägige orale Verabreichung durch und fanden keine Hinweise auf toxische oder mutagene Effekte. Selbst bei der höchsten getesteten Dosis von 400 mg/kg Körpergewicht pro Tag traten keine Organschäden oder signifikanten Nebenwirkungen auf.
Einzelfallberichte
Ein Bericht aus dem Jahr 2023 beschreibt den Fall einer 38-jährigen Frau, die wegen einer entzündlichen Beckenerkrankung ins Krankenhaus eingeliefert wurde [7]. Da Lithium mit einigen der notwendigen Medikamente interagieren kann, wurde ihr Lithiumspiegel gemessen. Es stellte sich heraus, dass sie Lithiumorotat einnahm und ihre Serumkonzentrationen bei unter 0,05 mmol/L lagen, sodass die erforderlichen Medikamente ohne Risiko verabreicht werden konnten. Dies deutet darauf hin, dass Lithiumorotat weniger problematische Wechselwirkungen zeigt als Lithiumcarbonat.
Lithiumorotat als Nahrungsergänzungsmittel
Lithium gilt in vielen schulmedizinischen Kreisen als potenziell gefährlich – vor allem wegen der bekannten Nebenwirkungen bei hochdosierter Gabe von Lithiumcarbonat. Dabei wird häufig übersehen, dass bei Lithiumorotat andere Dosierungen und pharmakokinetische Eigenschaften gelten.
Ein Fallbericht aus der Notaufnahme der Universität Pittsburgh (2007) [8] beschreibt die Einnahme von 18 Tabletten Lithiumorotat durch eine 18-jährige Frau – insgesamt 82,8 mg elementares Lithium. Die Symptome: leichte Übelkeit, einmaliges Erbrechen und Zittern. Klinisch ergaben sich keine gravierenden Befunde. Nach Gabe von Flüssigkeit intravenös besserte sich der Zustand innerhalb weniger Stunden vollständig – ein milder Verlauf, der keine spezifische Entgiftung erforderlich machte.
Zum Vergleich: Eine vergleichbare Lithiumdosis aus Lithiumcarbonat hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schwerwiegenderen Nebenwirkungen geführt – darunter Nierenbelastung, neurologische Ausfälle und in Einzelfällen sogar Intoxikation mit vitaler Gefährdung.
Dieser Unterschied zeigt: Nicht die Substanz „Lithium“ ist per se das Problem, sondern Form, Dosis und Kontext der Anwendung. Lithiumorotat ist in niedrigen Dosierungen – wie sie für eine Nahrungsergänzung vorgesehen sind – deutlich besser verträglich und weist ein gänzlich anderes Risikoprofil auf als therapeutisch eingesetztes Lithiumcarbonat.
Fazit
Wer Lithium nur als Medikament gegen schwere psychische Störungen betrachtet, hat den eigentlichen Schatz dieses Elements noch nicht erkannt. Lithiumorotat zeigt: Es kommt auf die Form, die Dosis und den Kontext an. In niedrigen Mengen wirkt es nicht sedierend, sondern stabilisierend – auf das Nervensystem, auf die Stimmung, auf die Zellgesundheit.
Gerade in Zeiten zunehmender Reizüberflutung, mentaler Erschöpfung und neurodegenerativer Erkrankungen lohnt sich der Blick auf sanfte Mikronährstoffstrategien. Lithiumorotat ist kein Wundermittel – aber möglicherweise ein fehlender Baustein. Vorausgesetzt, man denkt in Systemen und nicht in Symptomen.
Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:
Quellen:
[1] Lithium: ein wichtiges Mineral mit breiter klinischer Wirkung | Clinicum St. Georg
[2] Lithium orotate: A superior option for lithium therapy? – PubMed
[3] Different pharmacokinetics of lithium orotate inform why it is more potent, effective, and less toxic than lithium carbonate in a mouse model of mania – PubMed
[4] Kidney function and lithium concentrations of rats given an injection of lithium orotate or lithium carbonate – PubMed
[5] Rat brain and serum lithium concentrations after acute injections of lithium carbonate and orotate – PubMed
[6] A toxicological evaluation of lithium orotate – PubMed
[7] [Confusion caused by dietary supplement lithium orotate] – PubMed
[8] Lithium toxicity from an Internet dietary supplement – PubMed
 Rene Gräber:
Rene Gräber:
Ihre Hilfe für die Naturheilkunde und eine menschliche Medizin! Dieser Blog ist vollkommen unabhängig, überparteilich und kostenfrei (keine Paywall). Ich (René Gräber) investiere allerdings viel Zeit, Geld und Arbeit, um ihnen Beiträge jenseits des „Medizin-Mainstreams“ anbieten zu können. Ich freue mich daher über jede Unterstützung! Helfen Sie bitte mit! Setzen Sie zum Beispiel einen Link zu diesem Beitrag oder unterstützen Sie diese Arbeit mit Geld. Für mehr Informationen klicken Sie bitte HIER.

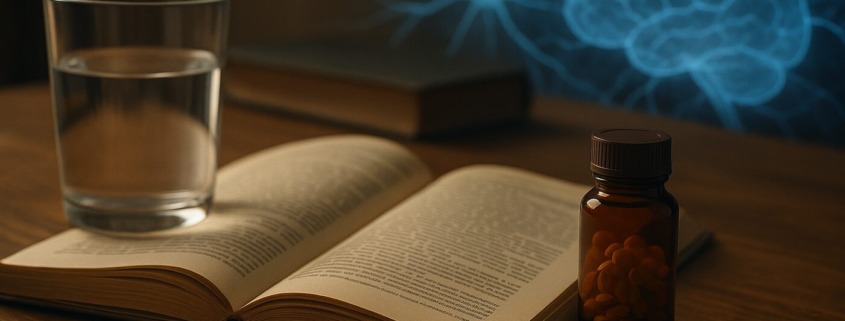
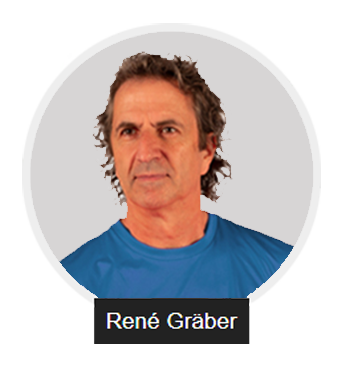 Rene Gräber:
Rene Gräber:



